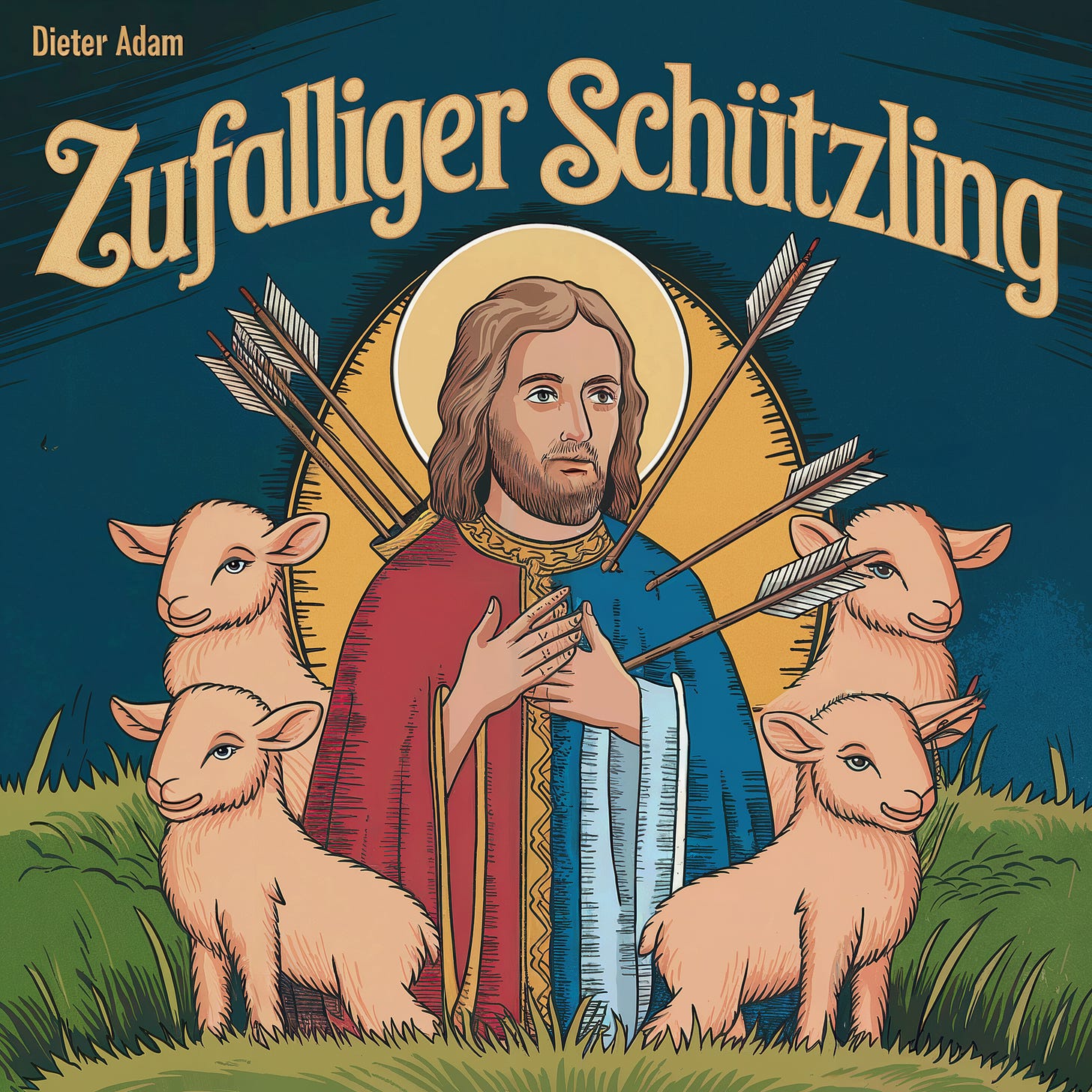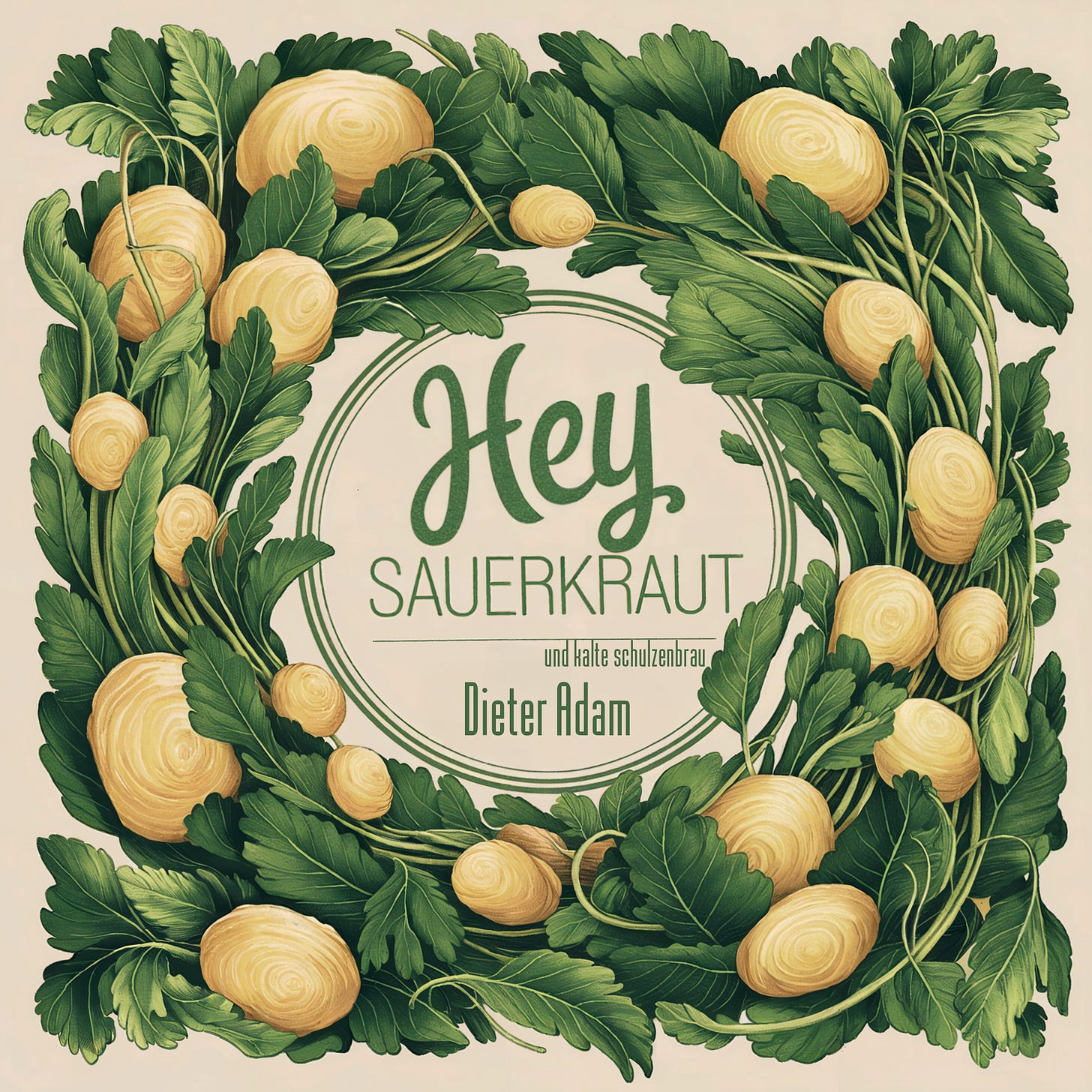Interviewer: Ihre beiden neuen Tracks, „Hey Sauerkraut“ und „Zufälliger Schützling (Death in June Cover)“, scheinen ganz bewusst zwischen Klamauk und Ernsthaftigkeit zu pendeln. Ist das ein Spannungsfeld, das Sie bewusst ausloten?
Dieter Adam: Absolut. In der deutschen Musiklandschaft fehlt mir oft genau diese Balance. Entweder wird alles todernst präsentiert, so als dürfe man bloß nicht aus der Reihe tanzen, oder es gerät in einen platten Witz ab, ohne jeden Tiefgang. Ich versuche, diese beiden Pole zusammenzubringen. Das Absurde und das Ernste, der scharfe Kommentar und das verschmitzte Zwinkern – all das darf durchaus in ein und demselben Stück existieren. Ich will damit zeigen, dass wir in Deutschland auch anders können, dass wir uns nicht ständig in einen einseitigen künstlerischen Tunnel begeben müssen.
Interviewer: Ihr „Sauerkraut“-Song („ich hab ne stau im flaut“) klingt nach einer Art vermischtem, ver-“verholländischtem“ Deutsch. Ist das ein Resultat Ihrer Zusammenarbeit mit einem niederländischen Dichter? Warum diese Kooperation?
Dieter Adam: Ja, genau. Die Zusammenarbeit mit diesem verrückt-genialen holländischen Dichter hat meinen Blick auf die Sprache und den Ausdruck völlig verändert. Er hat mir gezeigt, dass man eine Textidee von der Seite anstechen kann, von der man es am wenigsten erwartet. Als ich die Zeilen schrieb, erinnerte mich dieses seltsame Durcheinander aus Sprachen und Bildern an eine Phase in meinem Leben, in der ich – sagen wir, „unter dem Einfluss gewisser Substanzen“ – mit ziemlich banalen, aber seltsam berührenden Problemen konfrontiert war. Zum Beispiel das schier unendliche Warten, bis man endlich urinieren konnte. Dieses Gefühl, festzustecken und nicht rauszukönnen, obwohl man es so nötig hat, hat mich damals irgendwie in eine tiefere, fast tragische Gefühlslage versetzt. Und als der Holländer dann mit seinem eigenwilligen Sprachmischmasch kam, fühlte ich mich sofort verstanden. Diese absurde Verknüpfung von Körperlichem, Sprachlichem und Emotionalem ist etwas, was ich als extrem befreiend empfinde.
Interviewer: Sie sind bekennend schwul und gleichzeitig, wie Sie betonen, unverkennbar deutsch. Lässt sich das gut miteinander vereinbaren?
Dieter Adam: Ich denke, wir leben in einer Zeit, in der Scham immer weniger Platz haben sollte – ob es nun um Sexualität geht oder um nationale Identität. Lange Zeit wurde meiner Generation eingeredet, sich für ihre deutsche Herkunft irgendwie schämen zu müssen, so als sei da ein Makel, ein nicht abwaschbarer Fleck. Aber genau das ist es doch, was uns von innen zerfrisst: die ständige, oft unartikulierte Scham. Genauso wie ich irgendwann den Mut gefunden habe, offen schwul zu leben, möchte ich jetzt auch offen deutsch sein können, ohne ständig vorbelastete Geschichten mitschleppen zu müssen. Es ist wie ein doppeltes Coming-out: eines aus dem dunklen Schrank der Sexualität und eines aus dem Keller der Historie. Beides bedeutet, Grenzen neu auszutarieren. Man muss vorsichtig sein, nicht in billigen Nationalstolz oder arrogante Selbstüberhöhung zu verfallen, genauso wie man nicht ins Klischee vom schrillen Schwulen abrutschen sollte. Diese feine Grenze ist politisch und philosophisch, sie ist aber auch zutiefst persönlich. Das Ausbalancieren ist harte Arbeit, aber es lohnt sich, denn nur so entsteht Raum für ein authentisches, befreites Leben.
Interviewer: Was für Musik möchten Sie zukünftig machen? Warum planen Sie für 2025 sowohl eine Solodance-Platte als auch eine New Wave / Neue Welle Platte mit The Stoss?
Dieter Adam: Ich glaube, wir brauchen alle ab und an einen Ausbruch aus dem Dunkel. Die Welt ist kompliziert, chaotisch, manchmal bitter – das wissen wir alle. Doch sie ist eben nicht nur düster. Ich will mit meiner Musik zeigen, dass aus Zwiespalt auch Energie, aus Schwere auch Leichtigkeit erwachsen kann. Deswegen einerseits eine Soloplatte, die in den Rausch des Tanzens führt, die Körper und Seele gleichzeitig durchschüttelt und befreit. Andererseits die Zusammenarbeit mit The Stoss, bei der wir versuchen, den Geist der New Wave neu zu erfinden, diese Mischung aus Melancholie, scharfen Rhythmen und kühler Eleganz. „Sauerkraut und Schulzenbräu“ – das sind nicht nur schräge Bilder, das ist mein Versuch, die ernste deutsche Mentalität mit einer gewissen Leichtigkeit zu benetzen, um dann, wenn der Beat einsetzt, alles einmal gründlich durchzuschütteln. 2025 soll ein Jahr sein, in dem man gleichzeitig tanzen und denken darf, in dem der Bass unter die Haut geht, ohne dass man das Hirn an der Garderobe abgeben muss.
Interviewer: Sie haben kürzlich den Begriff „Krautdance“ ins Spiel gebracht. Können Sie erklären, was dahintersteckt? Warum soll es Krautrock geben, aber keinen Krautdance?
Dieter Adam: Sehen Sie, Krautrock hat längst seinen Platz in der Musikgeschichte gefunden: der mutige, improvisatorische Sound, geboren in den späten Sechzigern, verschmolz Avantgarde mit Rock und Elektronik. Aber warum dort stehenbleiben? Warum diesen kosmischen Pflanzendschungel, aus dem so viel entstanden ist, nicht in die Beine verlagern und den Körper tanzen lassen? Ich will die verstaubte Idee, dass Kraut nur in zähem, psychedelischem Ausloten von Klangräumen existieren darf, aufbrechen und sie in eine neue, pulsierende Körperlichkeit überführen. Krautdance ist für mich eine Art „botanische Alchemie“: Wir nehmen das Kraut – ein Sammelsurium an Erinnerungen, Traditionen, Träumen und Verrücktheiten – und ziehen es durch den Filter der Tanzfläche. So entstehen Rhythmen, die keine nationalen Eintöpfe mehr sind, sondern hochprozentige Elixiere, in denen Achtzigerjahre-Rave, Berliner Kellerclubs und die Erinnerung an verklärte Landhausküchen zu einem brodelnden Sud verschmelzen. Ich sehe mich selbst als Krautdancemeister, als Gärtner einer neuen Klangbiologie, in der die Wurzeln so tief gehen, dass sie den Boden perforieren, um an neuen Stellen hervorzubrechen. Da ist nichts linear, nichts logisch – es ist ein wilder, schlingernder Tanz durch unser kollektives Unterbewusstsein, bei dem das Kraut zugleich Heilpflanze, Rauschmittel, Peitsche und Balsam ist. Wenn Krautrock einst den Geist erweitert hat, dann soll Krautdance den Körper befreien, bis er zu einer wippenden, lachenden, schweißenden und doch sinnenden Gestalt wird, die nicht fragt, was gestern war, sondern nur tanzt, als ob es kein Morgen gäbe.
Interviewer: Und abschließend, Dieter: Wenn Sie Ihre künstlerische Entwicklung und die gesellschaftlichen Verwerfungen um uns herum betrachten – wo sehen Sie sich selbst und Ihre Musik in zehn Jahren, und welche Rolle spielt dabei das, was wir gemeinhin „deutsche Identität“ nennen?
Dieter Adam: Wissen Sie, die Frage nach der Identität ist wie eine Schicht von Gestein, die unter ständigem Druck neu geformt wird. Deutschland, Europa, ja die ganze Welt ist in einem unablässigen Prozess der Verwandlung begriffen. Wir verschieben Grenzen – nicht nur politische, sondern auch innere, kulturelle, ästhetische. In zehn Jahren, so hoffe ich, werde ich an einem Punkt sein, an dem meine Musik nicht mehr als deutsch oder europäisch gelesen werden muss, sondern als etwas, das aus einem vielschichtigen Dialog mit der Welt entstanden ist. Eine Musik, die weder ihren historischen Ballast ignoriert noch davor erstarrt, sondern ihn verwandelt, transformiert, weiterspinnt.
Das „Deutsche“ wird dann nicht mehr diese starre Kategorie sein, sondern ein lebendiges Gewebe, durchwirkt von Einflüssen, Schichten, Brüchen und Narben. Und genau diese Komplexität ist es, die ich in meiner Kunst suchen werde: den Ort, an dem Wurzeln und Flügel einander nicht widersprechen, sondern ergänzen. Wenn wir begreifen, dass Identität nichts Statisches, sondern ein beständiges Werden ist, können wir vielleicht endlich aus der Angst vor Veränderung heraustreten. Meine Musik soll in zehn Jahren ein Echo dieses inneren Wachstums sein – kein Manifest, sondern ein dialogisches Gespräch, das niemals endet.